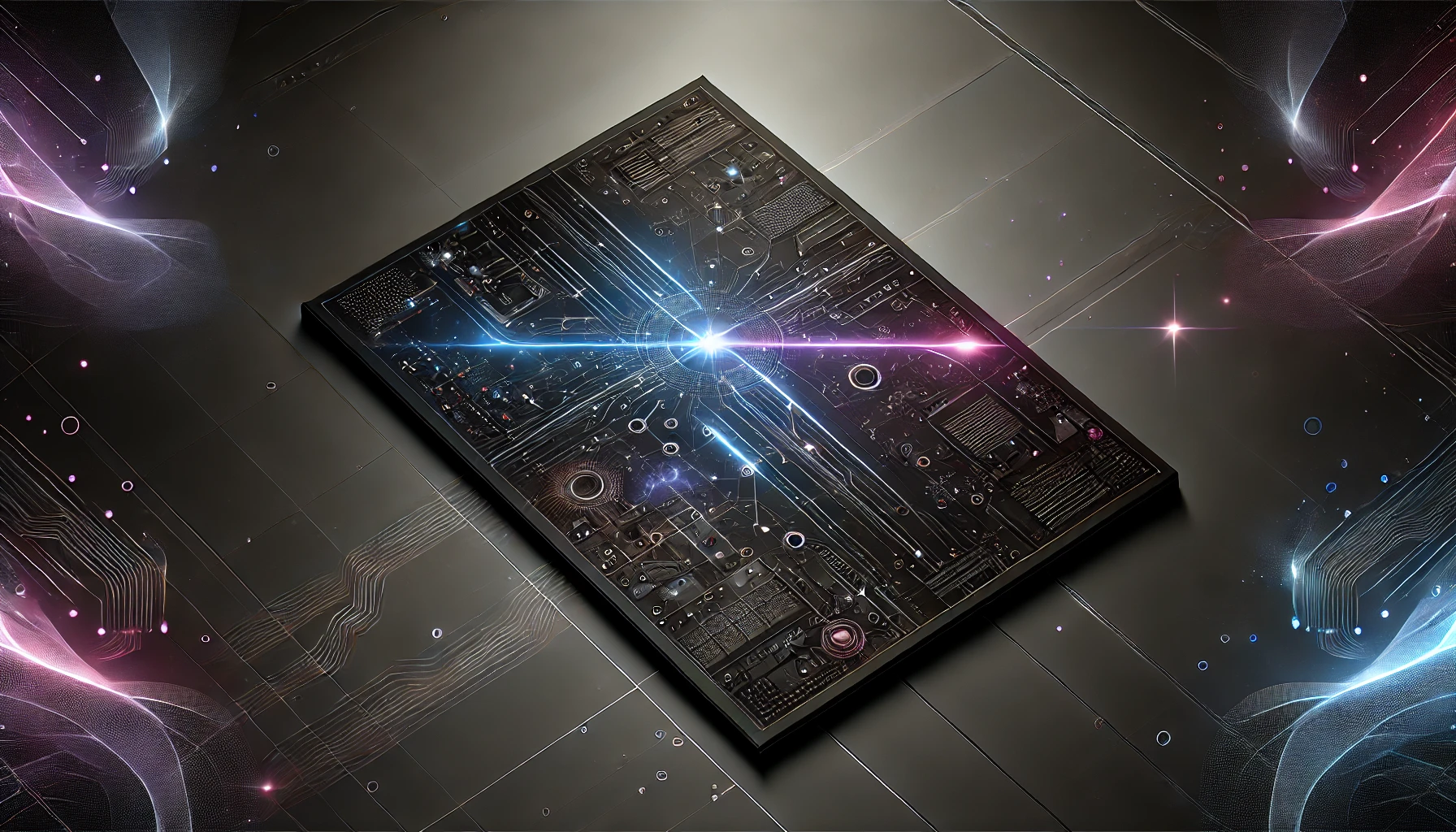Erwartungen und Realität
Eine aktuelle Untersuchung des AI‑Forschungs‑Nonprofit METR (Model Evaluation & Threat Research) kam zu dem Ergebnis, dass erfahrene Programmierer, die bereits mit einer Code‑Basis vertraut sind, durch KI‑Hilfen nicht produktiver, sondern 19 % langsamer wurden – trotz der Erwartung einer 24 %igen Beschleunigung. Die Entwickler schätzten im Nachhinein selbst eine Verkürzung der Arbeitszeit um etwa 20 %, obwohl in Wirklichkeit das Gegenteil der Fall war (Reuters, METR).
📌 Kernergebnisse der Studie:
- Erwartete Zeitersparnis: – 24 %
- Tatsächlicher Zeitverlust: + 19 %
- Gründe: Zeitaufwand für Prompting, Überprüfen und Korrigieren der KI‑Ergebnisse (~9 % der Gesamtzeit).
- Nur ca. 44 % der Vorschläge wurden übernommen (techradar.com).
Die Ergebnisse wurden in diversen Medien veröffentlicht, u. a. von Reuters, Business Insider und TechRadar .
Fazit: Eine reale Produktivitätssteigerung ist speziell im ersten Jahr der KI-Nutzung selbst für technik-begeisterte Menschen nicht zu erwarten, wenn selbst erfahrene Softwareentwickler immer wieder feststellen müssen, dass ihnen die ausreichende Erfahrung mit der Nutzung von KI noch fehlt, sich diese laufend verändert und sie weder die Zeit noch das zu investierende Kapital haben, um sich entsprechend neben dem Job ständig weiterzubilden. Das ist heutzutage als KMU parallel zum laufenden Betrieb ohne Expertennetzwerk für kleinere Firmen und “Universalgelehrte” praktisch nicht mehr zu stemmen.
Quelle: Eigene Erfahrungen 2022 bis 2025 — Werner Noske, Initiator Solidara.net (im Ruhestand)
Was sind die Ursachen?
Eine weitere von Microsoft Österreich in Auftrag gegebene Studie zeigt das sehr deutlich, wenn man sie als erfahrener Selbstständiger mit Hausverstand liest und nicht auf die großmundigen theoretisch machbaren Produktivitätssteigerungsversprechen für die Zielgruppe der kapitalstarken Konzerne hereinfällt, die Microsoft natürlich als Zielgruppe im Auge hat und denen ein riesiges Einsparungspotential durch die (US-amerikanische) KI versprochen wird.
Obwohl Abbildung 10 (Seite 15) der Studie zeigt, dass die Produktivität pro Mitarbeiter in Österreich bis 2022 kontinuierlich zugenommen hat, wird das Wirtschaftswachstum, auf dem alle Hoffnungen unserer Politiker in der EU beruhen, insgesamt eher immer schlechter (siehe Abbildungen 8 und 9, Seite 14).
Das liegt vor allem an der — bereits in mittelgroßen Betrieben — völlig unterentwickelten Digitalisierung. Dazu kommen die Corona-Folgen, die in den Statistiken noch gar nicht berücksichtigt sind. In Betrieben mit weniger als 10 Mitarbeitern, die die Masse der KMU in Europa ausmachen — und in Deutschland generell, sieht es wegen des fehlenden Eigenkapitals und den insgesamt schlechten politischen Rahmenbedingungen noch viel aussichtsloser aus als in Österreich — oder in vielen der osteuropäischen Nachbarländer, die mit dem EU-Beitritt ihre staatliche Verwaltung und ihre wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stark gestrafft und modernisiert haben.
Wie man in Abbildung 17 auf Seite 30 der Studie sehen kann, sind die digitalen Grundkompetenzen in der deutschen Bevölkerung im Vergleich zur Gesamt-EU deutlich unter Durchschnitt und weit hinter Österreich. Da macht sich dann auch noch unser über Jahrzehnte kaputt reformiertes Bildungssystem zusätzlich bemerkbar, das inzwischen nur noch mit der Integration von Migranten beschäftigt und völlig überfordert ist. Und das alles wird sich leider auch mit den geplanten Fördermaßnahmen für die deutsche Wirtschaft kaum verbessern, die sich ja allein auf wenige Industriekonzerne fokussieren und KMU-Dienstleister komplett im Regen stehen lassen.
Fazit
Die große Abhängigkeit Europas von US-amerikanischen Softwarelösungen in der Business-Software wird mit dem großflächigen Einzug der KI und dem enormen Know-How-Vorsprung der amerikanischen Großkonzerne die Konkurrenzsituation für kleine, lokale Unternehmen in Europa weiter verschärfen und den Überlebenskampf gegenüber kapitalstarken Großkonzernen von Jahr zu Jahr immer aussichtsloser machen.
Das einzige Konzept, als Selbstständige zu überleben, wird sein, sich mit vielen anderen Betroffenen zusammen zu tun und gemeinschaftliche Lösungen in funktionierenden Netzwerken gemeinsam zu entwickeln, permanent Verbesserungen zu testen bzw. von den immer weniger werdenden, noch verfügbaren und gleichzeitig bezahlbaren Fachkräften im Netzwerk aussuchen bzw. entwickeln und zentral für alle supporten zu lassen. Dafür eignet sich für kleinere Firmen vor allem ein genossenschaftlicher Ansatz — ähnlich wie ihn die Datev seit vielen Jahren in Deutschland für die Branche der Steuerberater umgesetzt hat. Eigenständige Individual-Lösungen in einzelnen Firmen sind in Zeiten des Fachkräftemangels in Zukunft immer nur schwer am Laufen zu haltendes Stückwerk und außerdem kaum noch bezahlbar.